WORK / ARBEITEN
Ich wollte mal Künstler werden
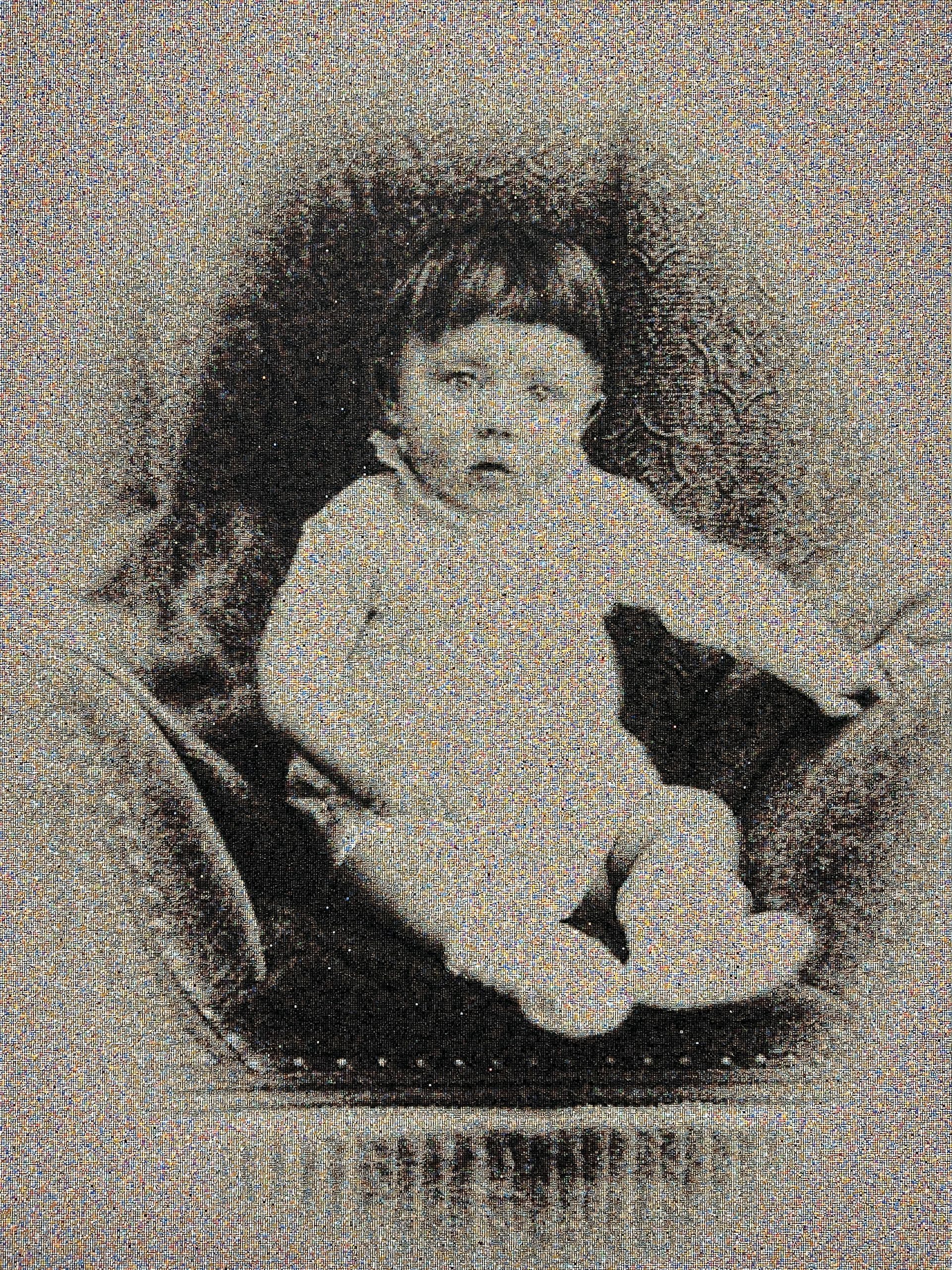 Info 🔗
Info 🔗- Bild
Ich wollte mal Künstler werden
Pigment auf Leinwand
Blauer Rahmen
200 x 150 cm
2025
Gutes Bild
 Info 🔗
Info 🔗- Bild
Gutes Bild
Pigment auf Leinwand
Blauer Rahmen
200 x 150 cm
2025
Der Ursprung der Welt
 Info 🔗
Info 🔗- Objekt
Der Ursprung der Welt (Typ H + Typ B)
Porzellan
Holografisches Textil
Acrylglas
Holz
Kunststoff
Aluminium
Edelstahl
25 x 19 x 6 cm
2025
Frequency
 Info 🔗
Info 🔗- Klanginstallation
Frequency
Resonanzlautsprecher
Sound: Stereo
Glasscheibe
200 x 90 x 1 cm
2024
Secession
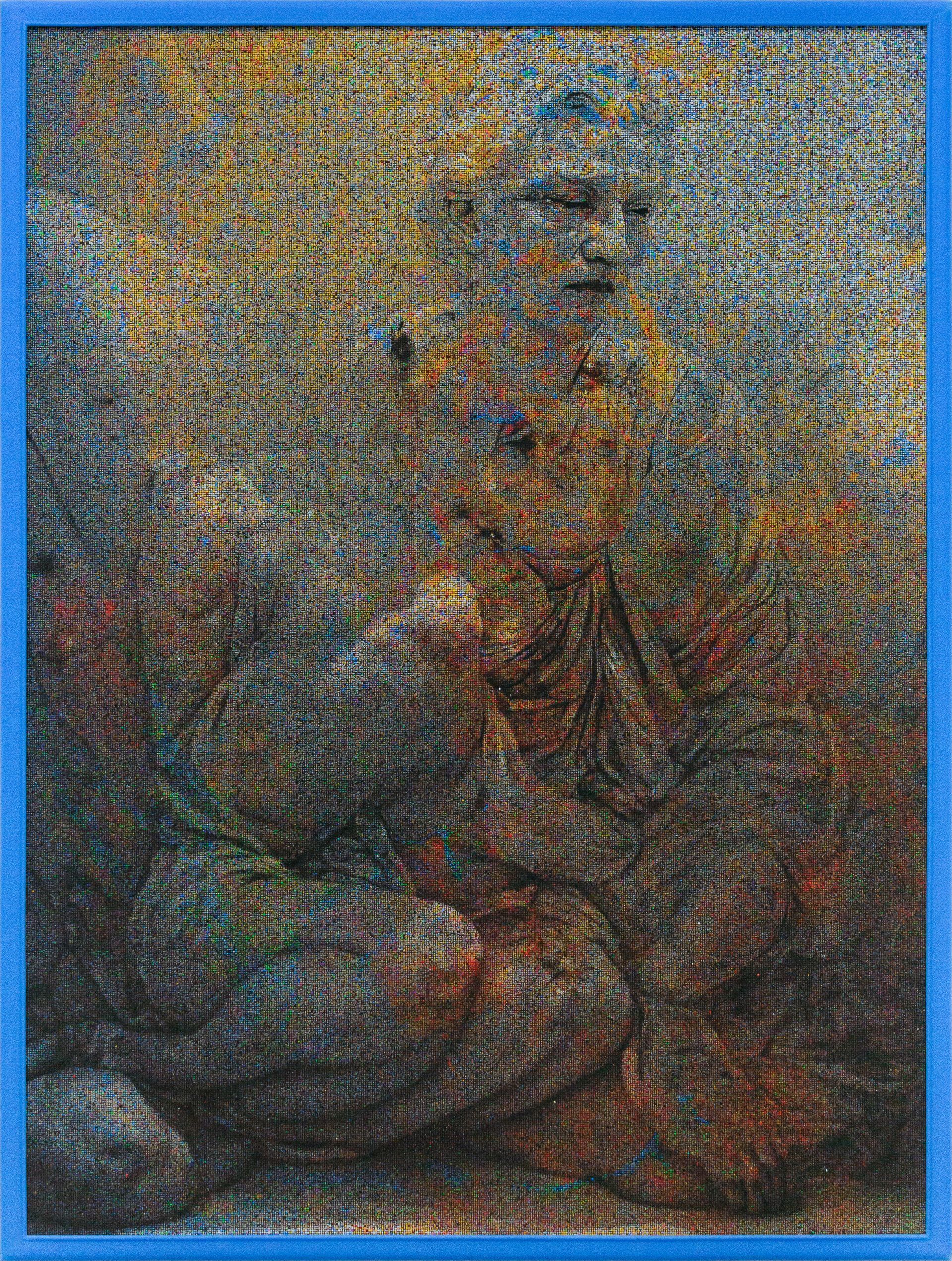 Info 🔗
Info 🔗- Bild
Secession
Pigment auf Leinwand
Blauer Rahmen
200 x 150 cm
2024
Zinnober (Secession)
 Info 🔗
Info 🔗- Raumklanginstallation
Zinnober (Secession)
Lichtspot
Resonanzlautsprecher
Fensterfolie (Rot-Orange)
Holografisches Textil
Styrodur
Sound: Stereo
Glaskasten: 171 x 158 x 102 cm
2024
Nur ein Nagel hat so etwas gern
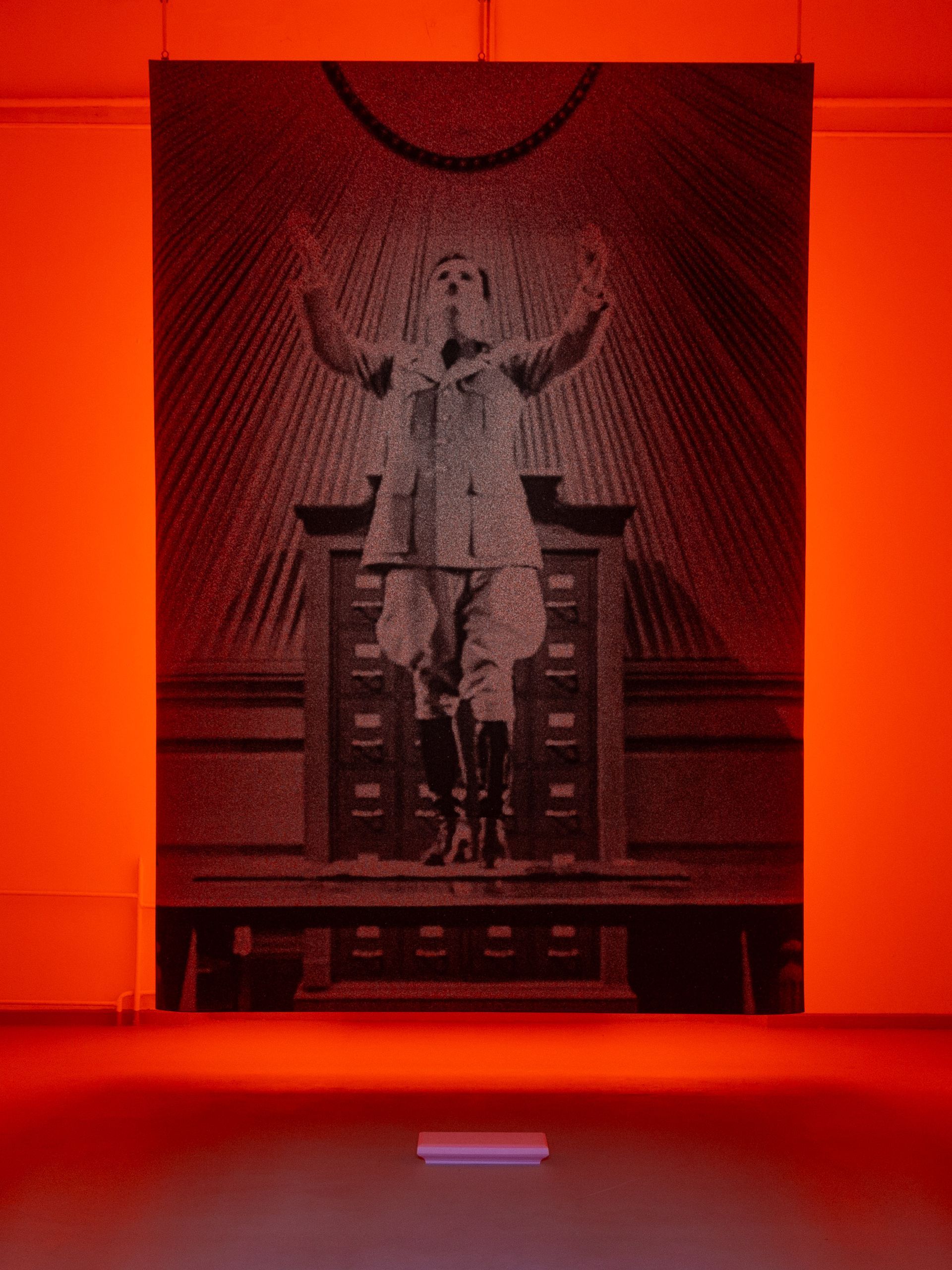 Info 🔗
Info 🔗- Rauminstallation
Nur ein Nagel hat so etwas gern
Styrodur
Folie (Rot-Orange)
Kupferblech
Holz
Sound: Stereo + Subwoofer
Pigment auf Archiv-Büttenpapier
ca. 800 x 1000 x 650 cm
2024
Gloria
 Info 🔗
Info 🔗- Objekt
Gloria
Blauer Samt
HDF Faserplatte
Metallbeschläge
Schachtdeckel
Beton
Gusseisen
29,5 x 88,5 x 63 cm
127 kg
2024
Ecce homo
 Info 🔗
Info 🔗- Rauminstallation
Ecce homo
Lichtspot
Molton
Absperrung zur Kontrolle von Menschenmengen
Pigment auf Archiv-Büttenpapier
gerahmt
ca. 200 x 450 x 300 cm
2023
HOLY SHIT
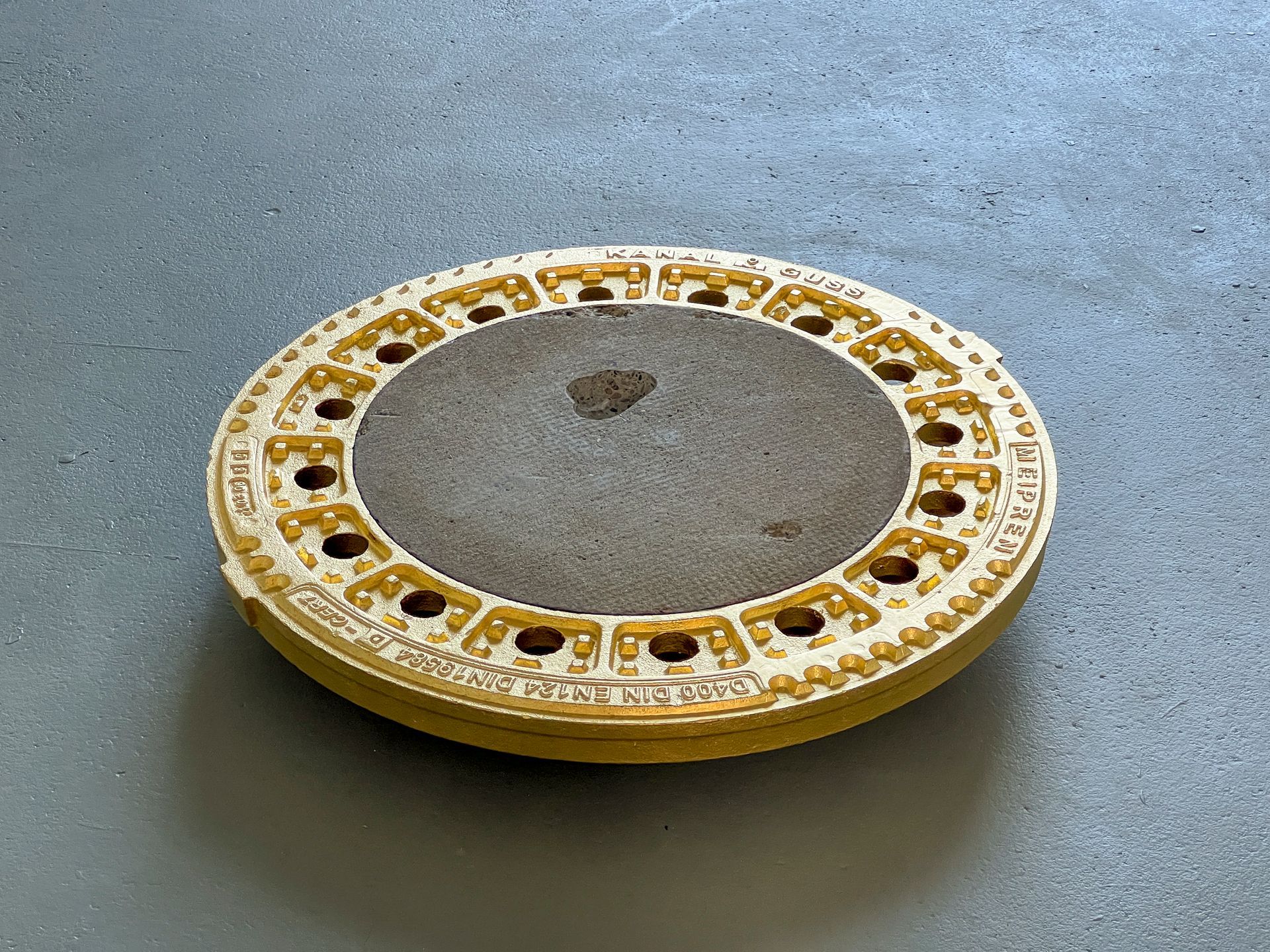 Info 🔗
Info 🔗- Objekt
HOLY SHIT
Schachtdeckel
Beton
Gusseisen
24 Karat Blattgold
⌀68 x 10 cm
118 kg
2023
Rothschild Persian Carpet
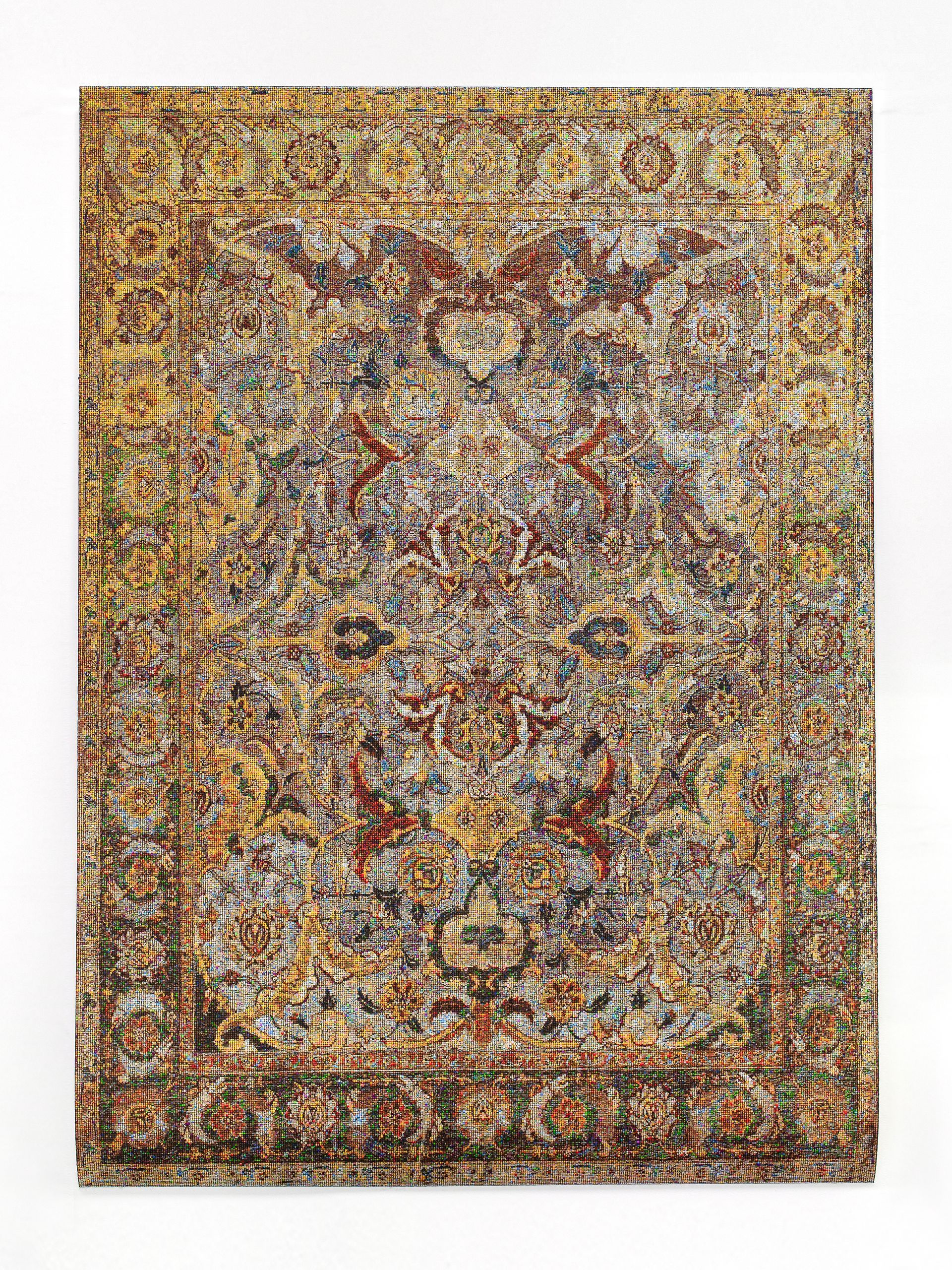 Info 🔗
Info 🔗Carpet Diem Series
- Objekt
Rothschild Persian Carpet
Aluminium
Pigment auf Archiv-Büttenpapier
197 x 141cm
2022
Liegende
 Info 🔗
Info 🔗- Bild
Liegende, (Diptychon)
Pigment auf Archiv-Büttenpapier
39,7 x 59,4 cm
2022
Clark Sickle-Leaf Carpet
 Info 🔗
Info 🔗Carpet Diem Series
- Objekt
Clark Sickle-Leaf Carpet
Aluminium
Pigment auf Archiv-Büttenpapier
267 x 196cm
2021
Faltenwurf Ω
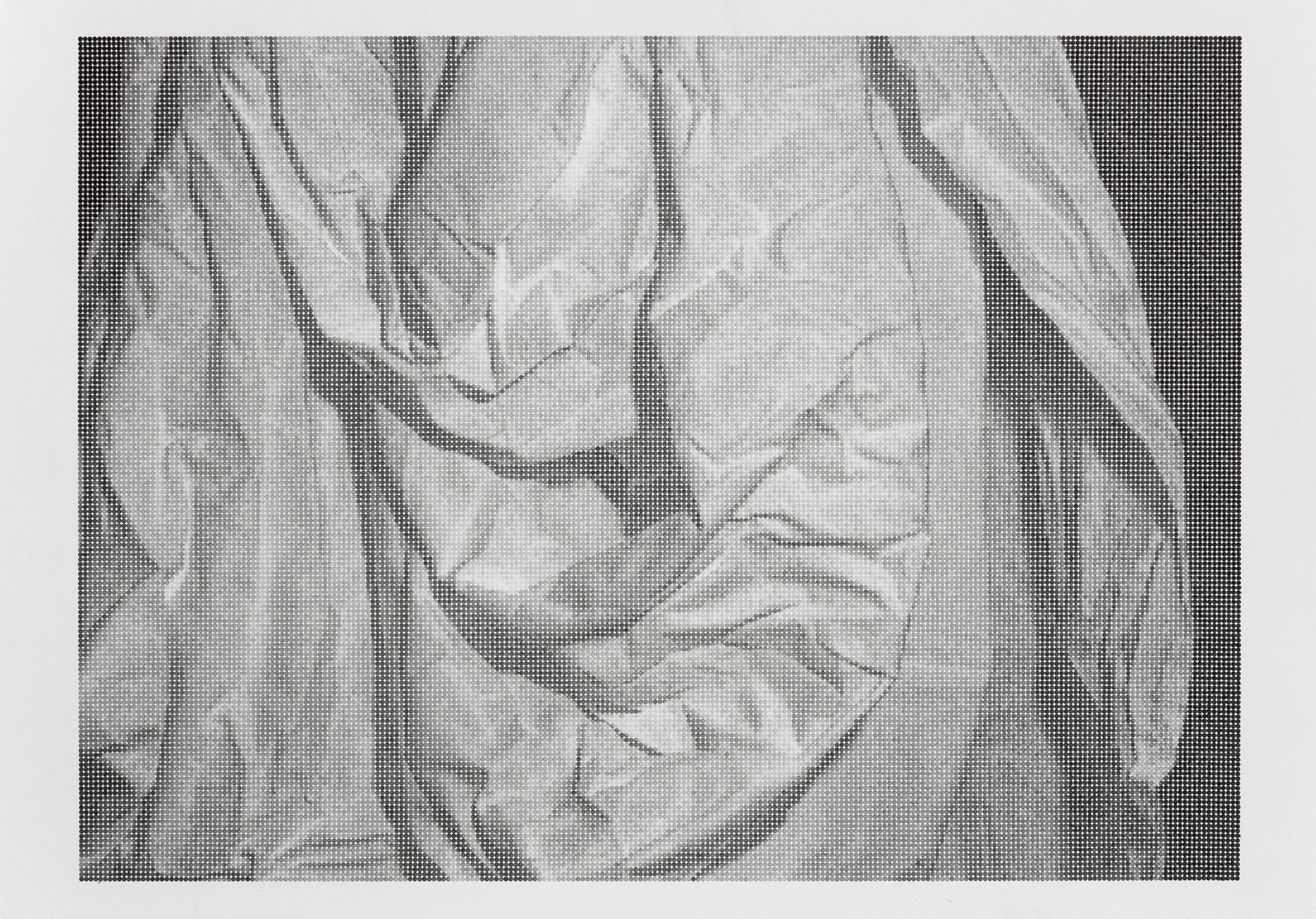 Info 🔗
Info 🔗- Bild
Faltenwurf Ω
Aquarell auf Papier
100 x 70 cm
2021
SEHSTÜCK
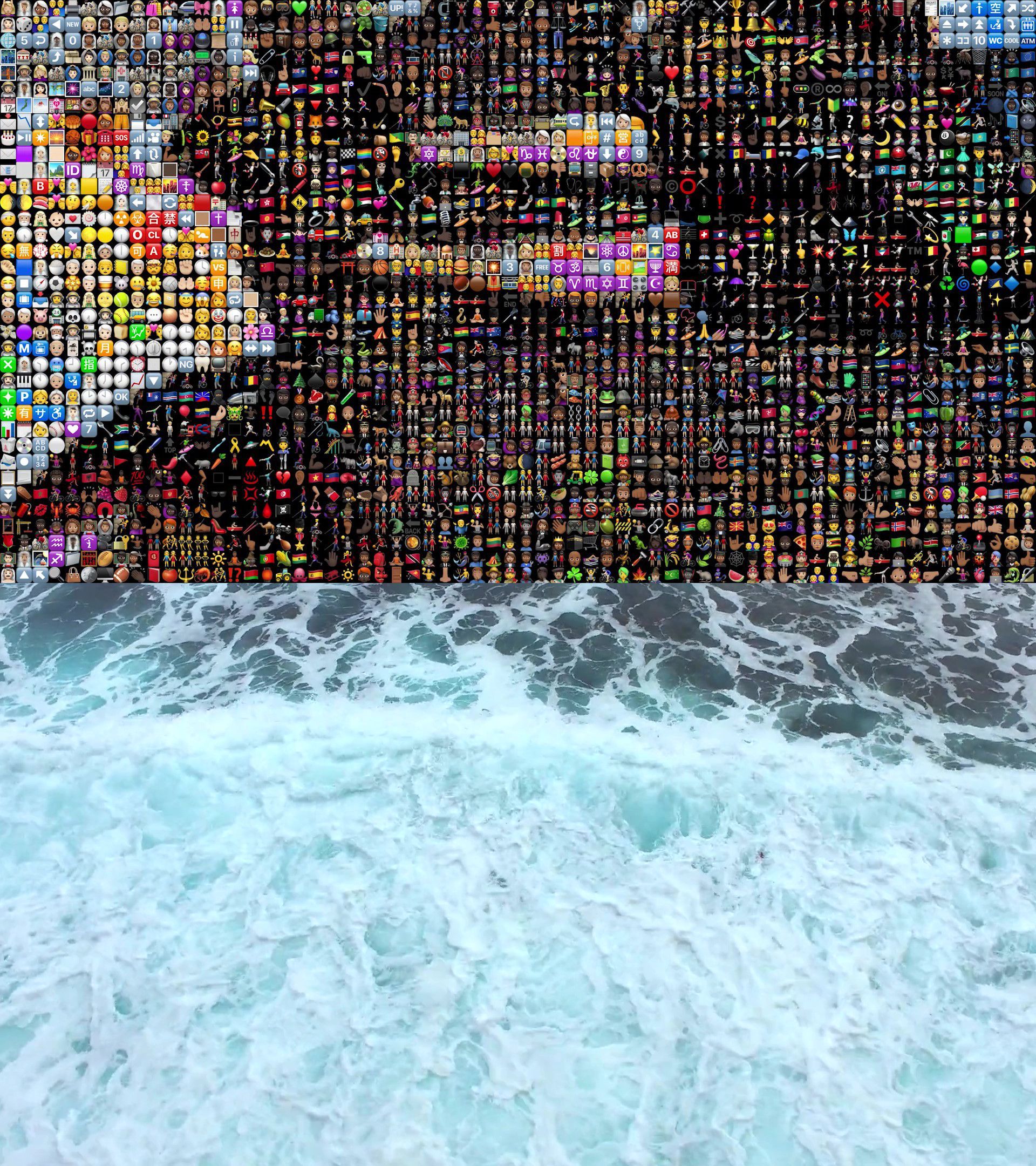 Info 🔗
Info 🔗- Video 🔗(Explicit Content)
SEHSTÜCK
Abb. Filmstill (Screenshots)
9:16 (1.080 x 1.920 px)
25 FPS
Sound: Stereo
02:55 min.
2021
Lügende Bilder
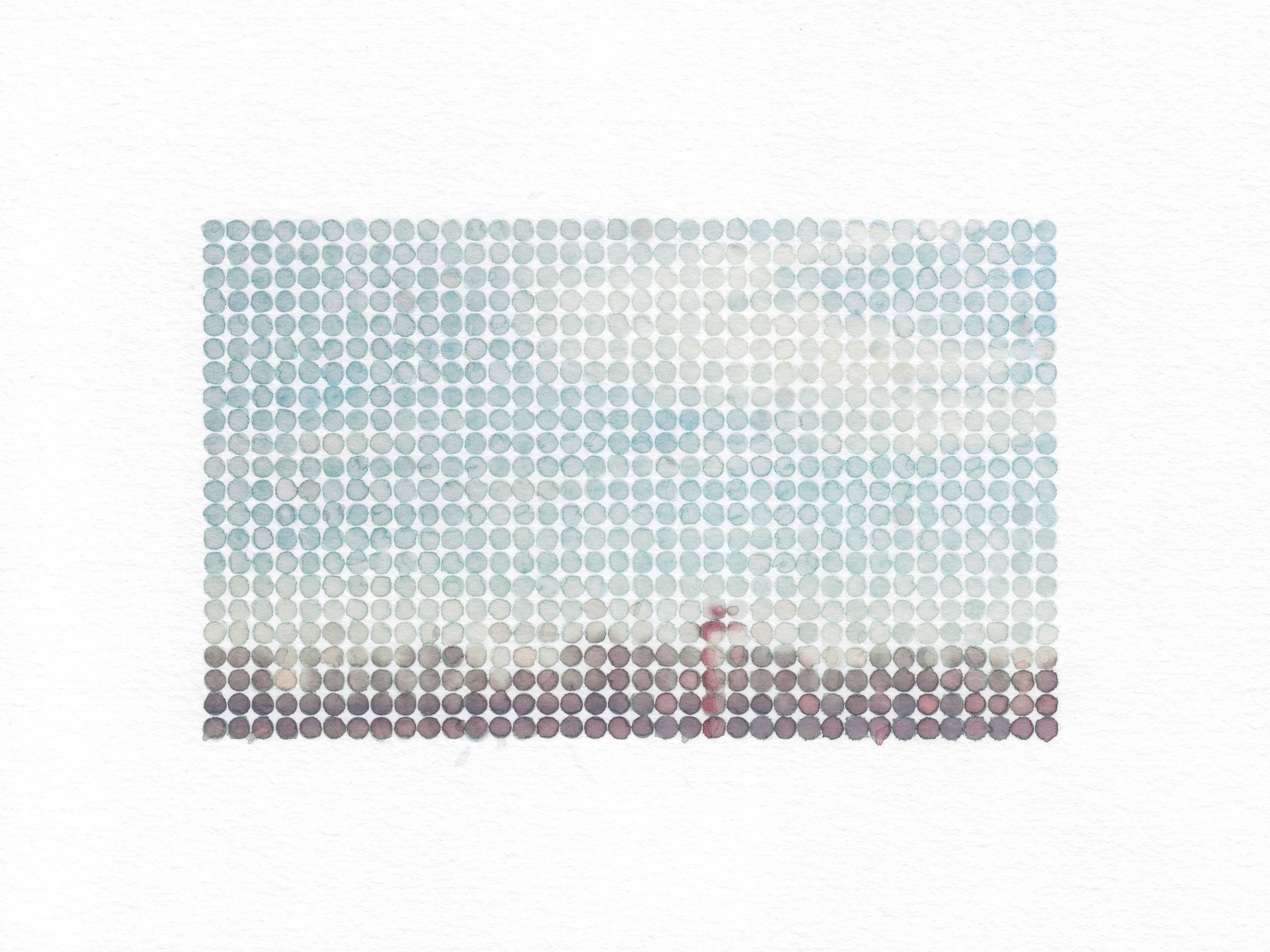 Info 🔗
Info 🔗Serie
Lügende Bilder
- Bild
Kinder #8
Aquarell auf Papier
alle 15 x 20 cm
2019/2025
ELECTRIC AVE
 Info 🔗
Info 🔗- Video
ELECTRIC AVE (Found Footage)
Abb. Filmstill (Screenshot)
9:16
25 FPS
Sound: Stereo
02:55 min.
2016
Porno-Grafisch
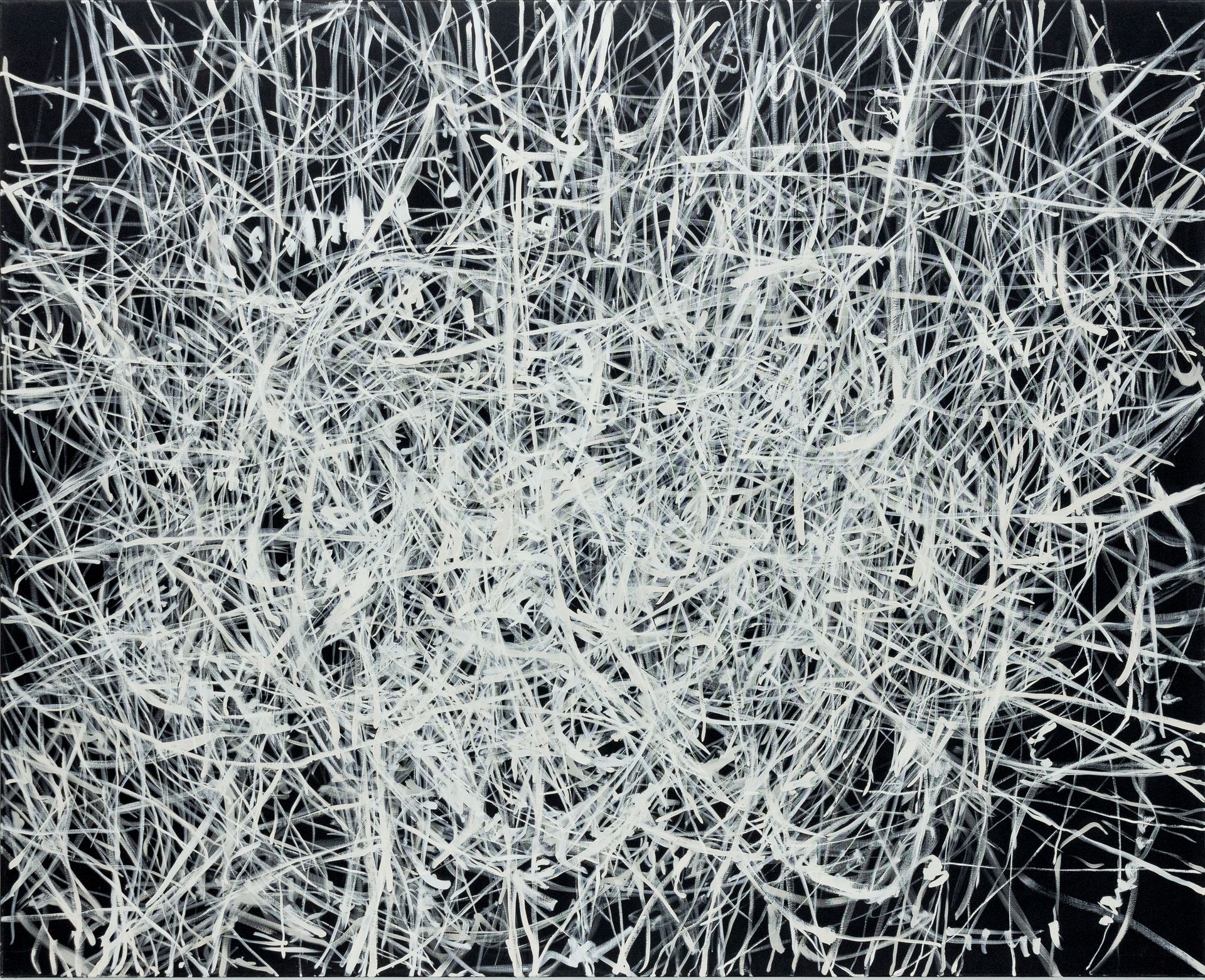 Info 🔗
Info 🔗- Bild
Porno-Grafisch
Öl auf Leinwand
178 x 220 cm
2018
einige Wolken ziehen nicht vorüber (Zinnober)
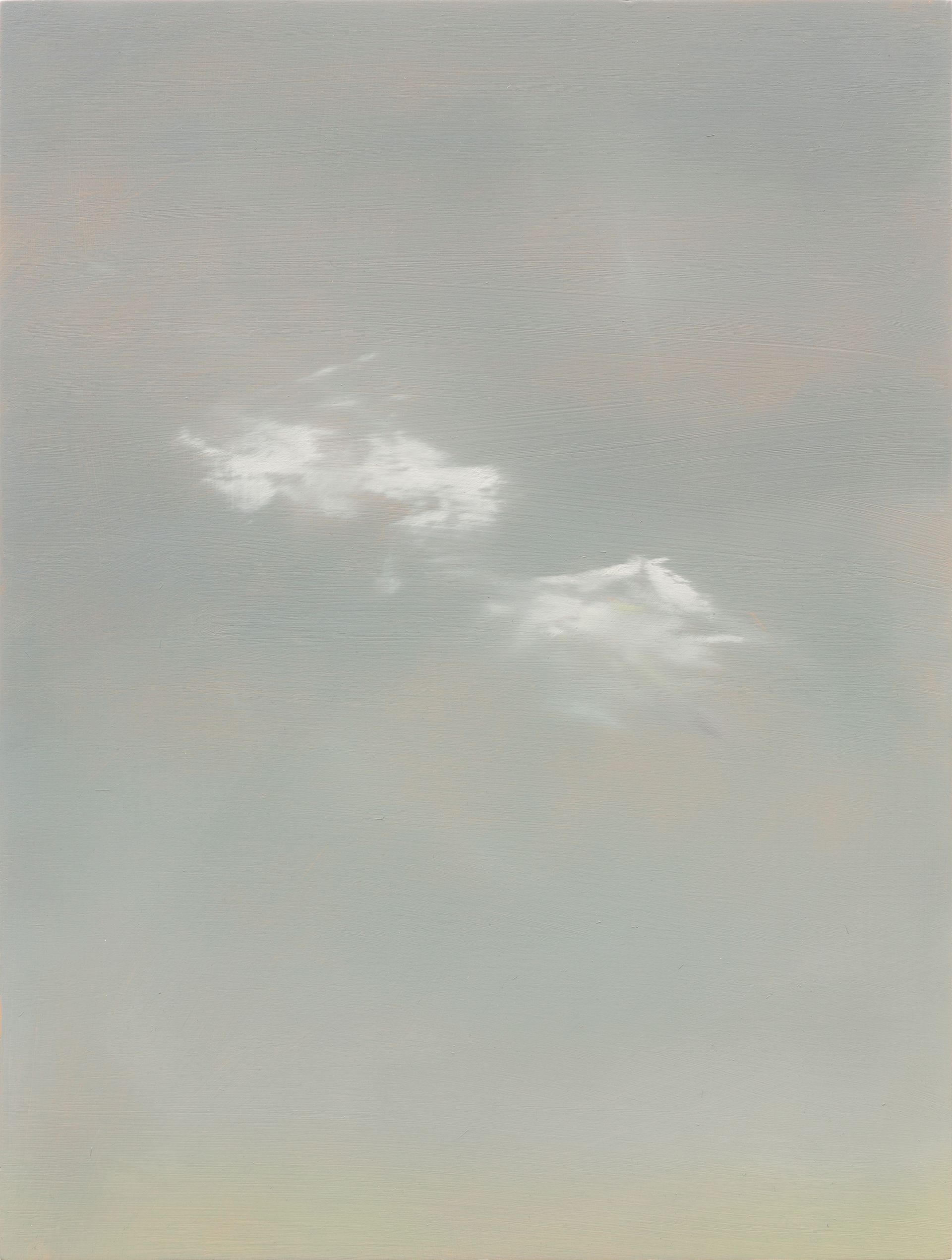 Info 🔗
Info 🔗Serie
einige Wolken ziehen nicht vorüber
- Bild
Wolke 7
Öl auf MDF Platte
alle 48 x 36 cm
seit 2017
Die neunte Symphonie
72 Jungfrauen (Huris)
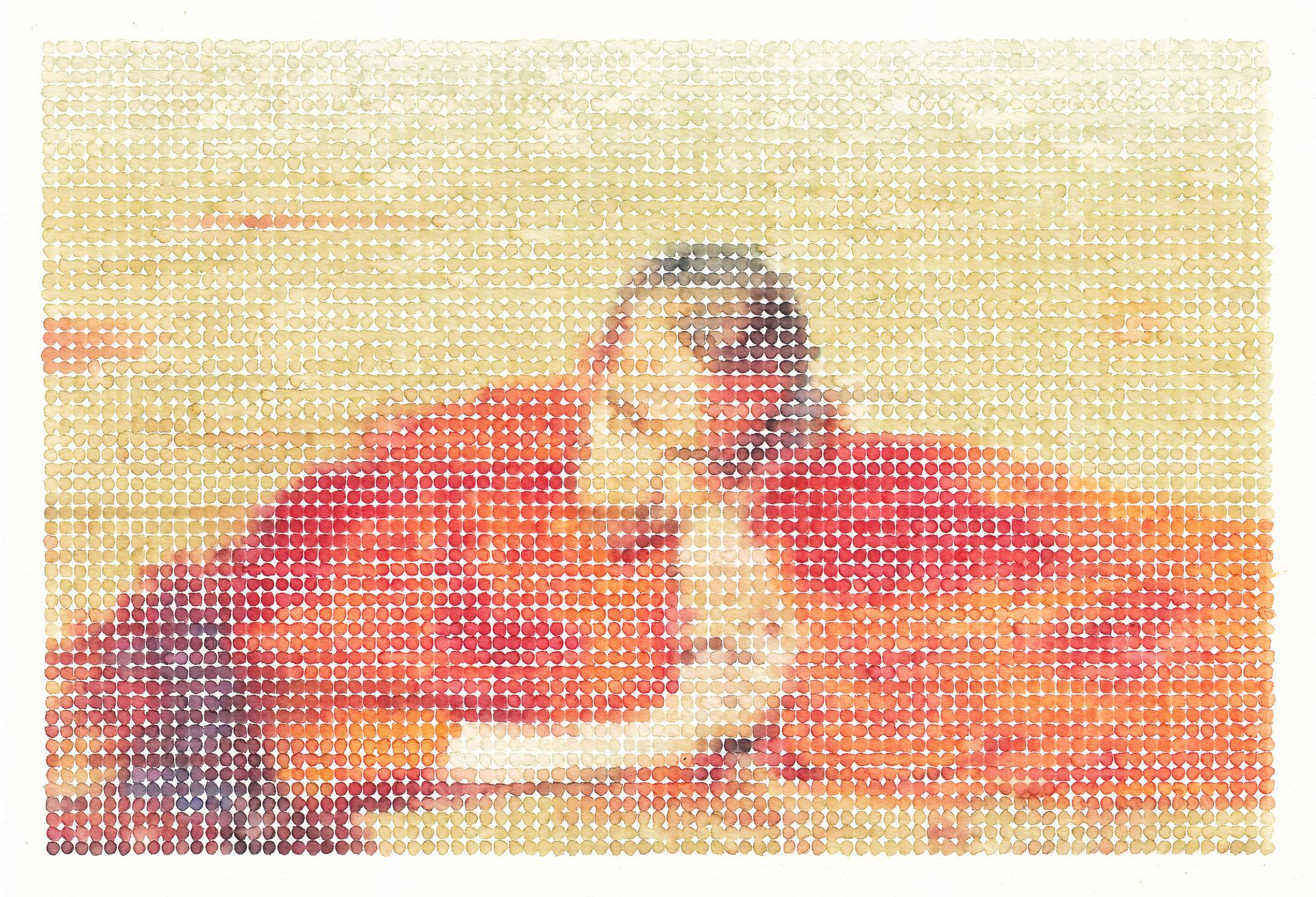 Info 🔗
Info 🔗Serie
72 Jungfrauen (Huris)
- Bild
nthptng #2
Aquarell auf Papier
alle 20 x 30 cm
2015
Autogramm
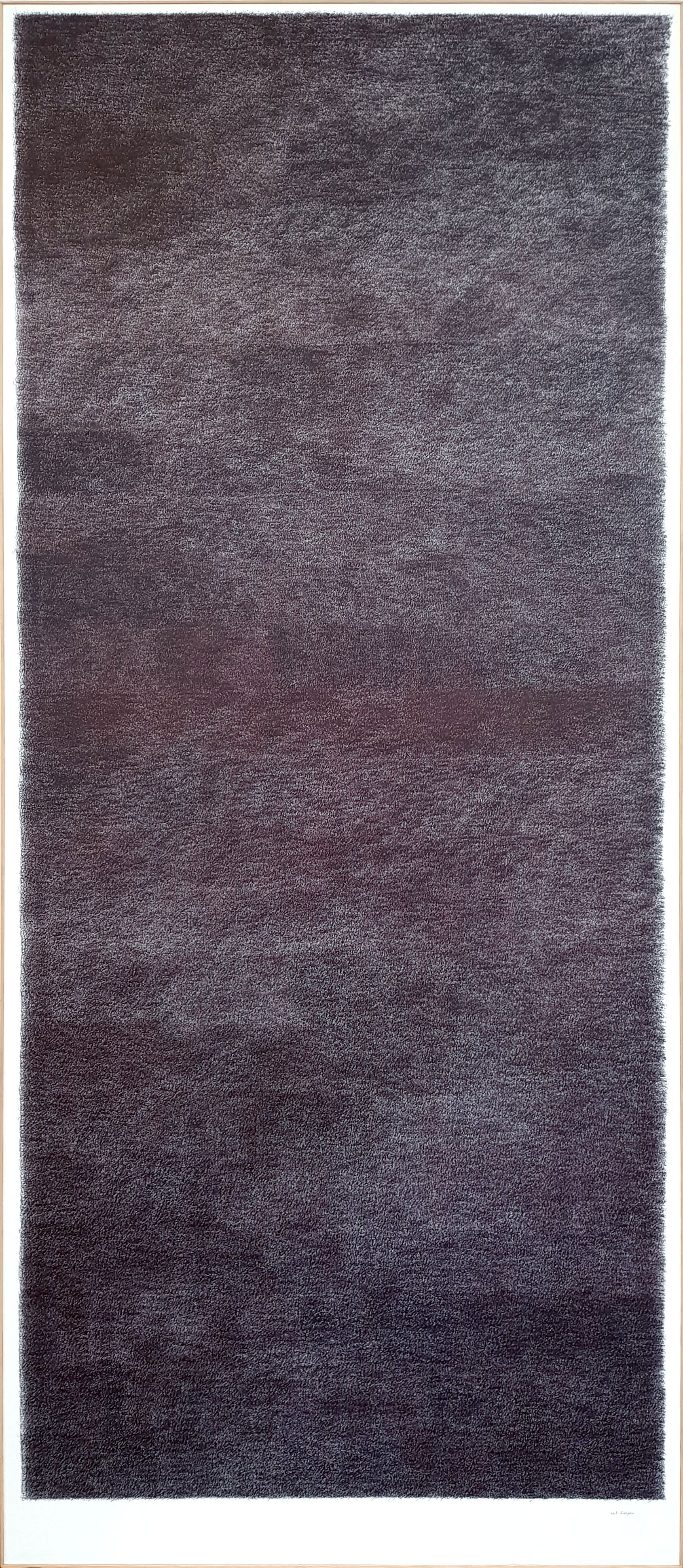
- Bild
Autogramm
Kugelschreiber auf Papier
210 x 98,7 x 2 cm
2014
